
Prof. Dr. phil. Antonio Alexandre Bispo
ANAIS

Prof. Dr. phil. Antonio Alexandre Bispo
ANAIS

Prof. Dr. phil. habil. Antonio Alexandre Bispo
neue diffusion
ein dokumentationsprojekt
ANAIS

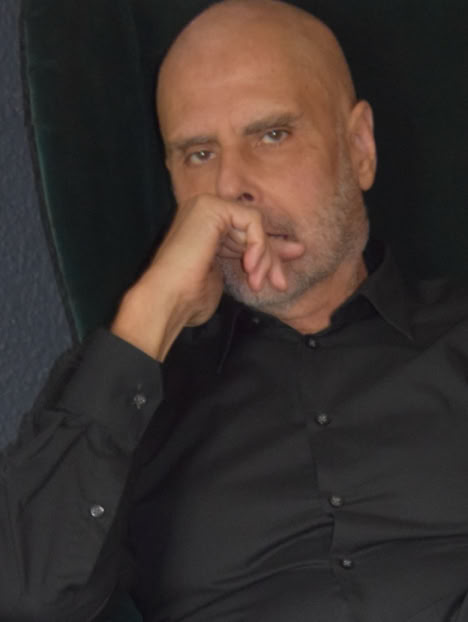
hans-georg burghardt
1909-1993

neue diffusion
ein dokumentationsprojekt
rückblicke
lehrveranstaltungen in brasilien
1970 - 1974
fakultät für musik und kunsterziehung des musikinstituts são paulo
fachbereiche ästhetik, ethnomusikologie und
fundamente der expression und kommunikation der menschen
vorausgehende studien und initiativen
zentrum für forschungen in musikologie
gesellschaft neue diffusion ND 1968
gesellschaft rudolf steiner 1970
schule higienópolis (waldorf-schule) 1970
tobias-klinik 1971
Hans Georg Burghardt war eine der anthroposophisch geprägten Musikerpersönlichkeiten Deutschlands, die bei den Studien zur Musik deutscher Komponisten des 20. Jahrhunderts im Rahmen des 1968 gegründeten Forschungszentrums in Musikologie der Gesellschaft Neue Diffusion in São Paulo berücksichtigt wurden. Dieses Programm hatte u.a. zum Ziel – entsprechend dem Anliegen der Bewegung zur Erneuerung von Denk- und Sichtweisen in Kultur- und Musikstudien –, wenig bekannte Komponisten und ihre Werke aufzudecken. Sie sollten nach Möglichkeit aufgeführt werden als Beiträge zu einer Diversifizierung des Konzertrepertoires. Die Auseinandersetzung mit ihnen sollte Einblicke in Entwicklungen des Musiklebens in Deutschland ermöglichen im Sinne der Bestrebungen zu einer kulturwissenschaftlich orientierten Musikwissenschaft in internationalen Zusammenhängen.
In dem Forschungszentrum wurde die als zunächst enigmatisch empfundene Tatsache thematisiert, dass es sowohl in der Literatur als auch in der Musik deutsche Autoren gibt, die in Vergessenheit geraten sind und im Kulturleben kaum beachtet wurden. Obwohl die theoretisch reflektierte Konstruktivität der Werke einiger Komponisten offensichtlich war und sie im weiten Sinne der Moderne zuzurechnen waren, wurden sie in Programmen nicht zur Musik der Avantgarde gezählt. Der Grund für den Sonderweg einiger Komponisten lag in der Nähe ihres Musikschaffens zu Anschauungen und Positionen der Theosophie und der Anthroposophie. Diese Problematik wurde bei den Konzerten zur Neuen Musik diskutiert, da sie auf eine Lücke in dem Panorama der zeitgenössischen Musikentwicklung des 20. Jahrhunderts hinweist.
Hans Georg Burghardt war zur Zeit dieser Studien am Institut für Musikwissenschaft in Halle tätig. Seine Kompositionen waren in Brasilien schwer erreichbar. Die Forschungen ließen jedoch die Bedeutung einer Auseinandersetzung mit seinem Leben, seinen Anschauungen und Kompositionen für Brasilien, insbesondere für die Studien deutschsprachiger Kreise São Paulos, die der Anthroposophie und der Kunst eines Gerhard Reisch (1899-1975) nahestanden, erkennen.
Burghardt, der in Breslau geboren war, richtete den Blick auf Schlesien und die deutsche Vertreibung nach dem 1. Weltkrieg. Damit war die Beschäftigung mit ihm von Bedeutung für Kulturstudien, die sich auf Migrationen bezogen, eines des Hauptanliegen der theoretischen Bestrebungen in Kultur- und Musikstudien im Zentrum für musikwissenschaftliche Forschungen der Bewegung Nova Difusão und des Moduls Europäische Studien/Europäistik des Fachbereichs Ethnomusikologie der Musikfakultät São Paulos. Die Auswanderung aus Schlesien war kaum Gegenstand von Studien in der Kulturforschung, obwohl schlesische Gemeinden vor allem in Südbrasilien zahlenmäßig und im Kulturleben von Bedeutung waren. Das Problem der Vertreibung von Ostdeutschen und deren Ansiedlung in Westdeutschland nach dem 2. Weltkrieg wurde in São Paulo kaum beachtet. Diese Problematik wurde auch bei dem zu dieser Zeit geförderten Interesse für die zeitgenössischen Musik Polens nicht berücksichtigt.
Die Beschäftigung mit Burghardt war für die Musikfakultät besonders von Interesse, da sein Lebenslauf gewisse Parallelen zu dem von Martin Braunwieser aufwies. Er gehörte zu den Komponisten des 20. Jahrhunderts, deren Werke zwar in den 1920er und Anfang der 1930er Jahre öffentliche Aufmerksamkeit genossen, die sich aber in der folgenden Zeit aus der Öffentlichkeit weitgehend zurückgezogen haben.
Werke von Burghardt wurden um 1930 durch den Breslauer Rundfunk aufgeführt. Danach widmete er sich vor allem der Lehrtätigkeit, ab 1950 im Konservatorium in Cottbus, anschließend am Institut für Musikerziehung der Universität in Jena. Wie Braunwieser widmete sich Burghardt in seiner Jugend der Vertonung von Texten von Christian Morgenstern (1871-1914), ein Dichter, der in anthroposophischen Kreisen besonders geschätzt wurde. Auch Braunwieser konnte seine anspruchsvollen Kompositionen noch Ende der 1920er und Anfang der 1930er Jahre der Öffentlichkeit vorstellen und wurde von einer Rundfunkanstalt – dem Rádio Educadora Paulista – unterstützt. Wie Burghardt widmete er sich in den folgenden Jahren vorwiegend der Musikerziehung.
Bei Begegnungen in der Waldorfschule Higienópolis von São Paulo wurde Hans Georg Burghardt besonders aufmerksam berücksichtigt. Seine Sonate opus 98 aus dem Jahr 1963 (Allegro giocoso, Adagio, Vivo) wurde analysiert und zu verschiedenen Anlässen an der Waldorfschule, am Zentrum für Forschungen in Musikologie und zuletzt am 28. August 1973 an der Fakultät für Musik und Musikerziehung des Musikinstituts von São Paulo aufgeführt und kommentiert.
Burghardt wurde im Fach Ästhetik, in dem auch Strukturlehre behandelt wurde, auch unter dem Aspekt seiner theoretischen Auffassungen berücksichtigt. Sein Konzept zur Umwandlung des terzbedingten Dur-Moll-Systems im Sinne eines erweiterten Sekundsystem wurde besprochen.
Die Nähe zur visuellen Kunst von Gerhard Reisch, die die Vorstellungen ätherischer Sphären und Wesen der Anthroposophie wiedergibt, fanden im Werk Burghardts Entsprechung in seinen Kompositionen für Harmonium, dessen Klang auch „ätherisch“ wirkt. Die Auffassungen von Burghardt waren im weiten Sinn pädagogischer Natur, da er die Musik als ein Vehikel des Menschen ansah, allerdings als Erziehungsinstrument der Gottheit. Werke von ihm für Harmonium wurden in Vorträgen im Konservatorium vorgestellt, das unter der Orientierung der Nova Difusão stand.
Das Harmonium wurde als notwendiger Gegenstand von kulturwissenschaftlich orientierten Musikstudien erkannt. Das Instrument war in der Mehrzahl der Kirchen anzutreffen, die vor allem in Siedlungsgebieten und in kleinen Städten nicht über Mittel für eine Orgel verfügten. Das Instrument war in einem bestimmten musikhistorischen Kontext in Europa entstanden und fand eine weltweite Verbreitung, die mit Kolonisierungs- und Missionierungsaktionen des 19. und des 20. Jahrhunderts zusammenhing. Es diente nicht nur ersatzweise zum Spielen von Orgel- und Klavierwerken sowie zur Begleitung des Gemeindegesangs. Für dieses Instrument waren auch eigene Kompositionen – wie die von Burghardt – entstanden. Wenn auch von der Musikforschung wenig beachtet, prägte das Harmonium mit seinen „ätherischen“ Qualitäten die Gefühlssphäre und religiöse Einstellung von Menschen in unterschiedlichen Kontexten, sei es in christlichen Gemeinden in Indien, auf den Inseln Ozeaniens oder in Lateinamerika.
Die Auseinandersetzungen mit Burghardt und dem Harmonium wurden im Zentrum musikwissenschaftlicher Forschungen der Nova Difusão auch praktisch geführt. Die Frage, wie sich die Klangeigenschaften und die Konnotationen des Instruments zu den sozialen und kulturellen Bedingungen Brasiliens verhielten, wurde bei einem Konzert für Flöte und Harmonium in der Pfarrkirche des Badeortes Mongaguá an der Küste von São Paulo 1972 mit Bernardo Toledo Piza als Solist aufgeworfen. Das Programm bestand aus adaptierten zeitgenössischen Werken für Flöte und Klavier und aus eigens dafür entstandenen Werken, u.a. einer Sonate für Flöte und Harmonium. Beziehungen zwischen den ästhetischen Qualitäten des Harmoniums und der von Geräuschen des Windes und des Meeres geprägten Wahrnehmung der Umwelt sollten erkundet werden.
Text basierend auf Niederschriften der Lehrveranstaltungen zu Musikästhetik und kulturwissenschaftlich orientierter Musikwissenschaft von A. A. Bispo an den Universitäten Bonn und Köln 2002-2008.